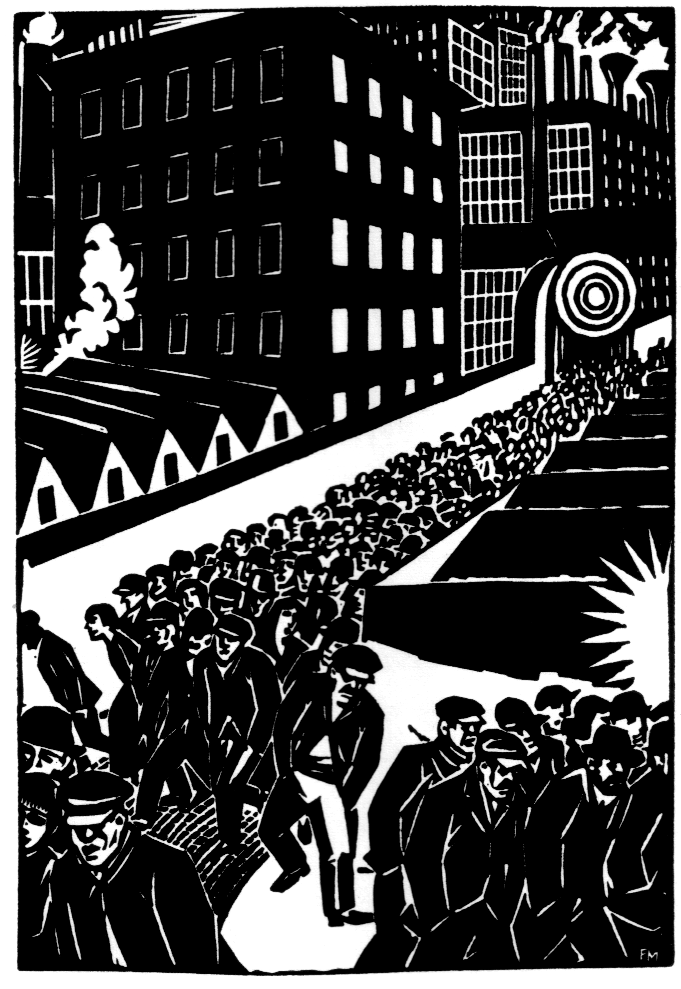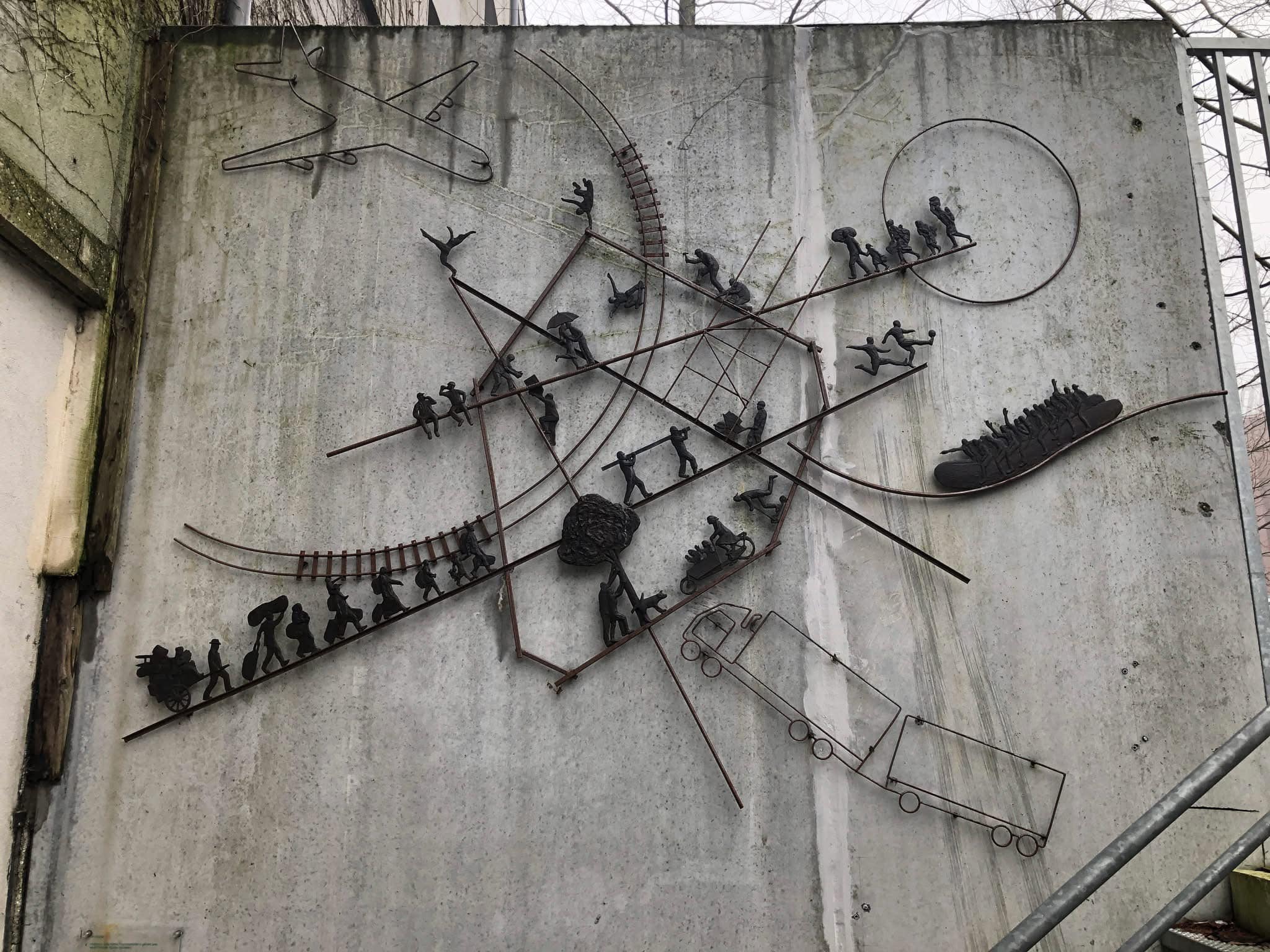“Die Gabe, Nationen zu schaffen, ist ein quid divinum, eine Gabe, die so unleitbar ist wie die des Dichters, Musikers oder Religionsstifters. Geistig ungemein hellen Völkern ging diese Fähigkeit ab, und anderen wissenschaftlich und künstlerisch weniger begabten war sie im höchsten Grade gegeben. Athen mit all seinem Scharfsinn vermochte nicht, das östliche Mittelmeerbecken zu einer Nation zusammenzuschließen, während Rom und Kastilien, zwei Völker von beschränktem Geist, die beiden gewaltigsten Staatsgebilde errichten haben, …
[Das staatenbildende Talent ist] … ein Herrrschertalent …, kein theoretisches Vermögen, keine reiche Phantasie und keine tiefe und mitreißende Gefühlsbewegtheit religiöser Art. Es ist ein Wollen- und Gebietenkönnen.
Gebieten aber ist nicht schlechthin ein Überzeugen und nicht schlechthin ein Zwingen, sondern eine feine Mischung aus beidem. … Bei jedem echten Eingliederungsprozeß ist die Gewalt Nebensache. Die wahrhaft wirkende Kraft, die ihn auslöst und treibt, ist immer der Glaube an eine nationale Aufgabe, ein einleuchtender Vorschlag zu einem Leben in Gemeinschaft. Wir weisen jede statische Deutung der nationalen Lebensgemeinschaft zurück und wollen lernen, sie dynamisch zu verstehen. Wenn Menschen zusammenleben, so hat das seine guten Gründe. Die Gruppen, welche einen Staat bilden, tun es für etwas: sie sind ein Zweck, ein Bedürfnis, eine Nutzgemeinschaft. Sie vereinigen sich nicht, um zusammen zu sein, sondern um zusammen etwas zu tun. …
Nicht das Gestern, das Vergangene, der überlieferte Besitz ist entscheidend für die Existenz einer Nation … Nationen bilden sich und bestehen aus keinem anderen Grund, als weil sie etwas für morgen vorhaben. …
Als es der traditionellen kastilischen Politik gelang, den klaren, durchdringenden Geist Fedinands des Katholischen für ihre Ziele zu gewinnen, was alles möglich gemacht. Der geniale aragonische Fuchs begriff, daß die Kastilier recht hatten. … Damals entstand Spanien. Aber wofür? … Man verbindet sich, um die Energien Spaniens in die vier Winde zu zerstreuen, um den Erdball zu überfluten um ein größeres und immer größeres Reich zu schaffen. … Das Ergebnis war, daß zum erstenmal in der abendländischen Geschichte die Idee einer Weltpolitik entstand: Spanien wurde geschaffen, um sie auszuführen. …
Solange Spanien Pläne zu verwirklichen hatte und sich ein Sinn hinter der Lebensgemeinschaft der Halbinsel abzeichnete, schritt die nationale Eingliederung fort. … Alles was [dagegen] seit 1580 in Spanien geschehen ist, [war] Niedergang und Zerfall … Es beginnt mit der Befreiung der Niederlande und Mailands, dann folgt Neapel. Im Anfang des 19. Jahrhunderts bröckeln die großen überseeischen Besitzungen ab und an seinem Ende die kleineren amerikanischen und pazifischen Kolonien. Um 1900 ist Spanien fast wieder beschränkt auf seine ursprünglichen Grenzen auf der iberischen Halbinsel. Doch die Auflösung geht weiter. …
Der Eingliederungsprozeß fügte bis dahin isolierte soziale Gruppen als Teile in ein Ganzes ein. Der Zerfallsprozeß geht in umgekehrter Richtung: die Teile des Ganzen beginnen wieder für sich zu leben. Diese Erscheinung des geschichtlichen Lebens nenne ich Partikularismus. …
Hiernach ist es klar, daß es mir leichtfertig erscheinen muß, wenn man die katalanischen und baskischen Unabhängigkeitsbestrebungen für künstliche, willkürlich von wenigen Ehrgeizigen aufgewiegelte Bewegungen ansieht. Ich halte sie vielmehr für das greifbare Symptom des Zerfallszustandes, in dem sich Spanien befindet. Die nationalistischen Theorien und die politischen Programme des Regionalismus sind allerdings von geringem Interesse und zum größten Teil künstlich. … Wer sich in der Politik an das Gesagte hält, wird kläglich untergehen. … Wesentlich für den Partikularismus ist, daß die einzelnen Gruppen aufhören, sich selbst als Teile zu empfinden, und infolge davon aufhören, die Gefühle der anderen Gruppen zu teilen. … Charakteristisch für diesen sozialen Zustand ist andererseits die Überempfindlichkeit für die eigenen Übel. Ärger und Schwierigkeiten, die in Zeiten des Zusammenstehens leicht genommen werden, erscheinen unerträglich, wenn die Seele der Gruppe sich aus der nationalen Gemeinschaft gelöst hat. …
Wenn ein Gemeinschaftswesen dem Partikularismus zum Opfer fällt, kann man immer ohne weiteres sagen, daß die Zentralmacht die erste gewesen sein muß, die davon ergriffen wurde. Und das ist in Spanien geschehen. Kastilien hat Spanien gemacht, und Kastilien vernichtet es. … Kastilien … lud die Völkerschaften der Halbinsel zur Mitarbeit an einem gewaltigen Projekt … ein … Unter Philipp III. jedoch wird eine verhängnisvolle Wandlung spürbar. … Kastilien verkehrt sich in sein äußerstes Gegenteil: es wird mißtrauisch, engherzig, geizig, übellaunig. Es ist wenig mehr darum bekümmert, die Lebensenergien der anderen Regionen zu erhöhen, es neidet sie ihnen eher und überläßt sie sich selbst …
Uns Spaniern sucht die öffentliche Gewalt seit langem einzureden, daß wir nur existieren, damit sie sich die Ehre geben kann dazusein. Da das ein reichlich fadenscheiniger Grund ist, zerbröselt und zerfällt Spanien.”
aus: José Ortega y Gasset: Aufbau und Zerfall einer Nation. In: ders.: Stern und Unstern. Stuttgart: DVA 1952, S.73-94. Span. Originalausgabe des Aufsatzes von 1922,
07/14