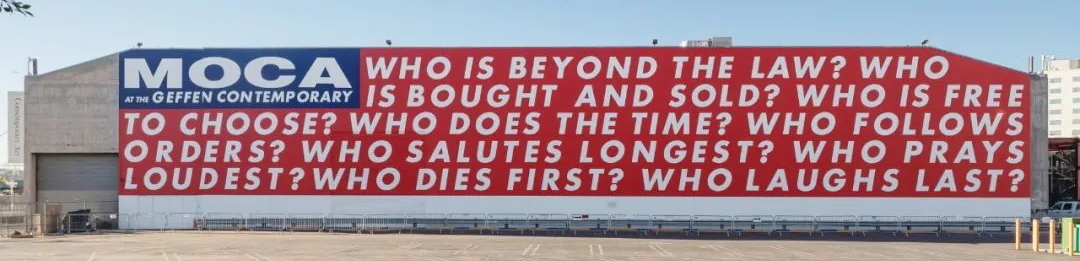“Ich gebe – du gibst – er nimmt.
Die Nehmer bringen die Konjugationen durcheinander. Er – sie es gibt müßte es ja eigentlich weitergehen, aber: Er nimmt. Die Nehmer vermehren sich.
Unser Miteinanderleben soll ein ständiges Geben und Nehmen sein. Ich gebe ihr oder ihm mein Vertrauen, er oder sie nimmt es. …
Die Nehmer sind die eigentliche Bedrohung unseres Gemeinwesens. Sie nehmen Arbeit und diese damit anderen weg, sie nehmen Lohn und damit denen, die ihnen diesen geben, die Lust an der Innovation, die Motivation, damit die letzte Bindung an die Nation, denn wo das Geld winkt, kein Deutschlandlied erklingt. Die Spezies der Geber, die im Lande bleiben wollen, steht bereits unter dem Artenschutzgesetz.
Die großen deutschen Geldwaschstraßen, die Großbanken also, die in Frankfurt so herausragend die Skyline bestimmen, haben es schon sehr früh begriffen: Deutschland ist eine Eisscholle, man muß schauen, daß man auf das Festland kommt. Ohne Hilfe von Großbanken hätte es die großen Finanzskandale nie gegeben. Ja, geben, Kredite geben, Vertrauen schenken. Banken sind, wenn man ihrer Werbung glaubt, besser als Mutter Theresa. Denn Mutter Theresa will ja, daß die Menschen, um die sie sich kümmert, gesund werden, was rücksichtslos ist, denn dann müssen sie ja wieder von vorn … Die Banken handeln viel humaner und erledigen die Leute absolut. Sterbehilfe auf nette Art.
Banken haben es mit einer gefährlichen Art von Menschen zu tun, die das Geldwesen nicht versteht und trotzdem mehr aus dem Geld machen will, das ihr gar nicht gehört. Der Bank gehört es auch nicht. Und genau das vermitteln die, die eine Bank betreiben, nicht.
Der Banker gibt mir ein Geld, das ihm gar nicht gehört. Ich schieße ihm erst mal Geld vor, damit er mir Geld gibt. Sein Entschluß, mir Geld geben zu sollen, basiert auf seinem ‘Gesamturteil’, das er von mir gewonnen hat. Ich mußte ihm sagen, was ich mit seinem Geld, das gar nicht seins ist, machen will, während er mit meinem Geld, das nicht mehr meines ist, Gewinne machen will, die nicht meine sind. Zwischendurch hat er mich ausspionieren lassen, was ich denn für ein Typ bin, wann ich nach Hause komme, mit wem ich zusammenlebe, welchen Einfluß eine sie auf mich ausübt, könnte ja auch ein Er sein, was die Sache sofort komplizierter machen würde, wie ich Auto fahre, was ich und wieviel ich trinke, ob ich kreditrückzahlungsgefährdende Hobbys habe, was es mit meiner zukunftsgefährdenden Geundheit auf sich hat, denn ‘die Nachbarn haben ihn seltsam husten hören’. Ja. Geld nehmen, das einem nicht gehört, erfordert eine Bereitschaft, sich ausforschen zu lassen.
Wer etwas nehmen will, muß alles geben. Und wenn er Pech hat, landet er unter der Brücke und die Bank hat seine Eigentumswohnung. …”
aus: Dieter Hildebrandt: Gedächtnis auf Rädern, München: Goldmann 1999 (Orig.-Ausg. 1997), S. 93-94.
12/11