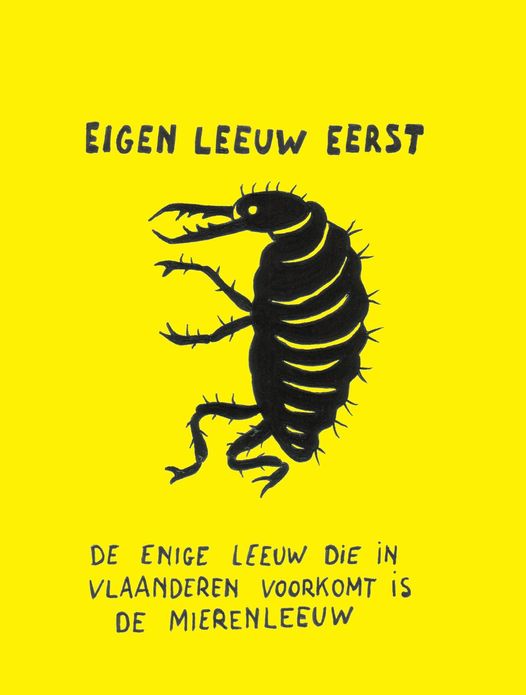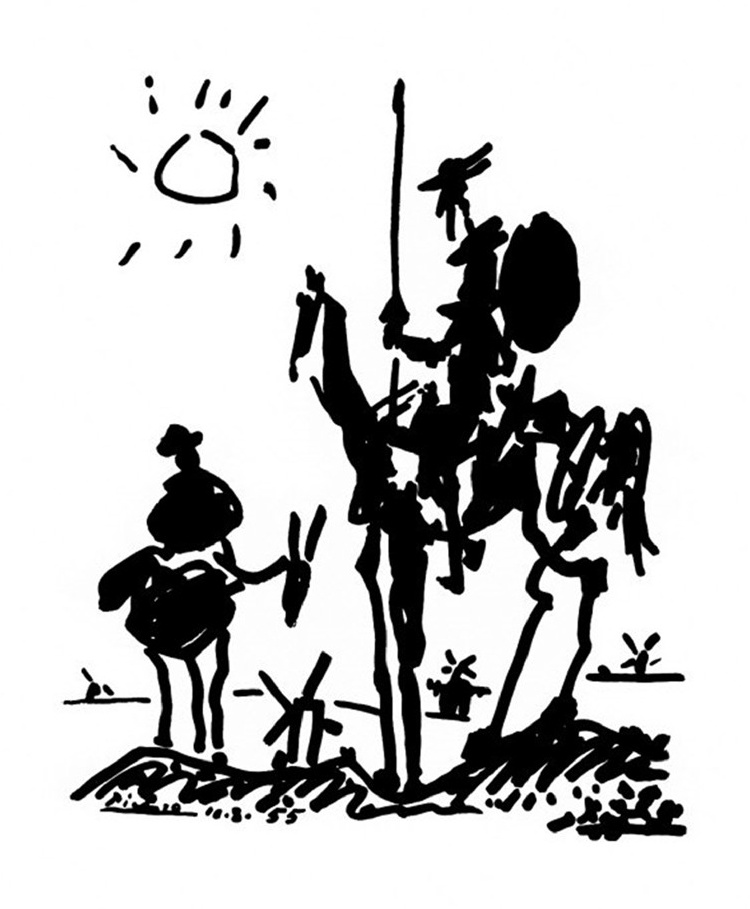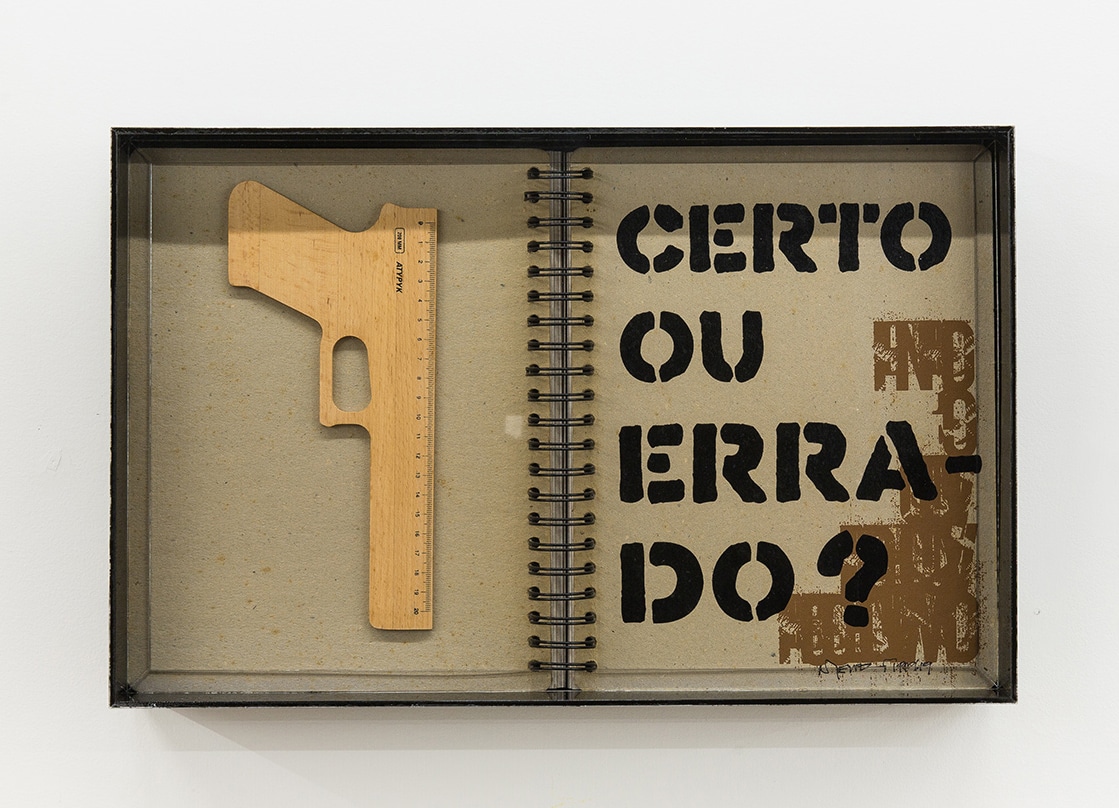Friedensbewegung
“Hört ein Bürger unseres Staates das Wort ‘Frieden’, beginnt er zu gähnen. … Die Friedensbewegung wird [hier] präsentiert als ein Ausdruck der Tatsache, daß die Menschen im Westen den Kommunismus sowjetischer Prägung gar nicht mehr erwarten können. …
Die westliche Friedensbewegung hat realen Einfluß auf das Handeln der Parlamente und Regierungen. Und riskiert kein Gefänginis. Hier riskiert man Gefängnis. Und der Einfluß auf die Entscheidungen der Regierung ist – jedenfalls in diesem Punkt – gleich Null. … [Der Osteuropäer] kann es noch nicht einmal erreichen, daß er mit Rücksicht auf die Zähne und Seelen der Kinder von Nord- nach Südböhmen umziehen darf; wie sollte er da so eine Sache beeinflussen können wie Sternenkriege zwischen zwei Supermächten! …
Zu den Gefahren, für die der hiesige Geist eine besonders empfindliche Nase hat, gehört auch … die Gefahr daß die lebendige Idee als Werk und Zeichen sinnvollen Menschseins zur Utopie als technischer Anleitung zur Vergewaltigung des Lebens und Vertiefung seines Schmerzes versteinert. … Wer beunruhigt uns hier mit einer Utopie? Welche nächsten Katastrophen werden uns hier – in bester Absicht – wieder vorbereitet? …
Wir fühlen hier irgendwie stärker …, daß der, der sich zu ernst nimmt, bald lächerlich wird, und wer ständig über sich selbst lachen kann, nicht wirklich lächerlich sein kann. … Das hiesige Mißtrauen gegenüber jedem Empathismus und jedem Engagement, das nicht der Distanz zu sich selber fähig ist, hat wohl auch Einfluß auf jene Zurückhaltung, die ich hier zu analysieren versuche. …
Es gibt selbstverständlich auch weitere Gründe für die Zurückhaltung … Die Tschechoslowaken haben zu gut am eigenen Schicksal erfahren … wohin eine Politik des Appeasement führen kann. … Die Grunderfahrung, daß es nicht möglich ist, schweigend Gewalt zu dulden, in der Hoffnung, daß sie von selbst aufhört, gilt noch immer. …
Für uns ist es einfach schon unverständlich, wie man noch an die Möglichkeit der Abrüstung glauben kann, die den Menschen umgeht oder sogar mit seiner Versklavung erkauft wird.”
Vaclav Havel: Anatomie einer Zurückhaltung. In: Am Anfang war das Wort. Reinbek: Rowohlt 1990 (geschrieben 1985)
09/92