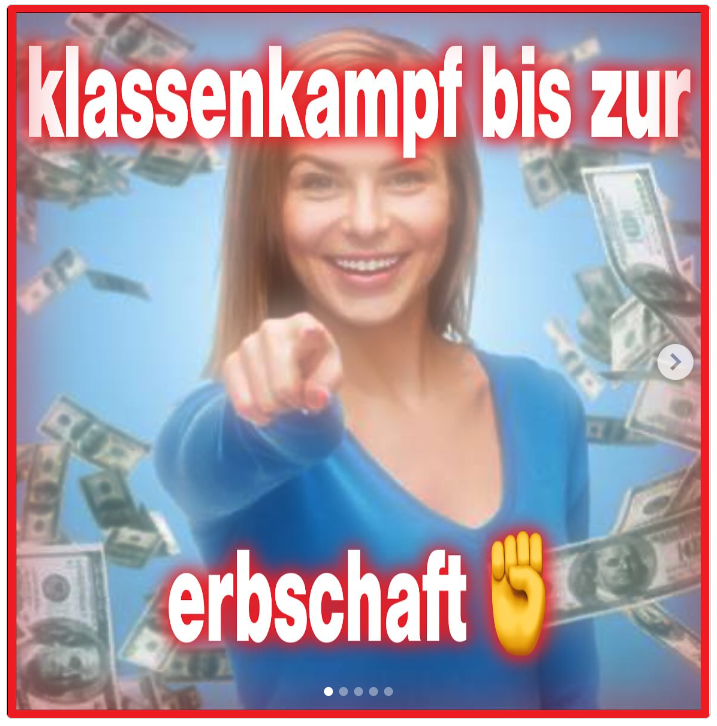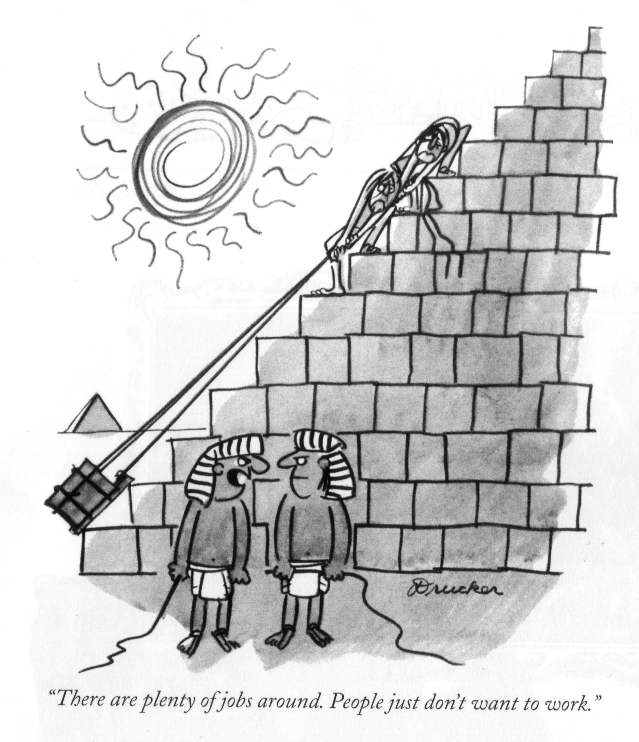Kinderwagens
Goeien Dag,
De lange reeks van lezersbrieven in uw en andere kranten over kinderwagens in het openbaar vervoer maken mij meer en meer woedend. Sinds 18 maanden ben ik nu vader en loop in Brussel en andere steden met zo’n ding rond.
Ik ben erg verbaasd over al die kindervijandelijkheid die uit de lezersbrieven maar ook de stellingen van de MIVB-voorzitter klingen.
Al de mensen, die zeggen, zelf als kind altijd in de armen van hun ouders door de wereld gedragen worden te zijn en dat kinderwagen voor niks zijn! Ik weet niet, voor wie al die kinderwagen zijn verkocht in de jaren vijftig en zestig? Ik was er in zo’n kinderwagen, als ik kind was. Hoe willen jullie urenlang een kind van rond 10 kilo op jullie armen dragen? Hoe willen jullie dan nog boodschappen doen of enkel en busticketje kopen?
Kleine kinderen hebben ook veel slaap nodig, en in een kinderwagen slapen ze heel goed. Overal in die weinige Europese steden, waar je principieel of ‘s avonds vooraan moet instijgen (op zich al een absurd maatregel die voor ellendige vertragingen en heel wat agressiviteit zorgt), kan je met een kinderwagen of en rolstoel achteraan instappen: Antwerpen, Hamburg, Stockholm, Marseille… Enkel in Brussel is dit onmogelijk. En het Brusselse openbaar vervoer heeft nu uitgerekend die busmodellen gekocht met het smalste doorgang achter de bestuurder!
Ik vind, recht te hebben op het openbaar vervoer, en mijn dochtertje ook. Ik weiger een rijbewijs te vragen, een auto te kopen en dan ook nog de zebra- en voetpaden te blokkeren zoals al zo velen, zonder dat er iemand wat tegen doet – probeer maar eens de Poststraat van Schaarbeek naar de Kruidtuin met een kinderwagen op het voetpad te wandelen …
En ga maar eens met de tram. In de oude modellen zijn enkel de deuren voorn en achteraan breed genoeg voor de kinderwagens. Eens ben ik uitgestapt, om aan en Afrikaanse vader, die vergeeflijk probeerde door de middendeur met een poussette in te stappen, te helpen het via de achterdeur te doen, als de chauffeur van de tram 90 de deuren slot om los te rijden. Enkel het protest van mijn vrouw (samen met ons kinderwagen binnen de tram) heeft hun van kunnen overtuigen de deuren nog eens open te zetten. “Des cons qui ne savent pas qu’au milieu, ce n’est pas assez large pour des poussettes, n’ont rien à faire dans mon tram”. Letterlijk. Maar meestal werkt het wel met de trams.
Maar er is niet enkel het openbaar vervoer. De brasserie “L’An Vert” in Schaarbeek heeft sinds een jaar een plakkertje aan de deur “verboden voor kinderwagens”. Als ik mij bezwaarde, zei die cafébaas, dat het enkel tegen Marokkaanse en Turkse kinderwagens was, en mijn blond dochtertje natuurlijk welkom was! En heel opmerkelijke redenering: Iedereen bezwaart zich over missende integratiebereidschap van de allochtonen, en dan kommen Turkse (!) vrouwen (!) in een Belgisch (!) café (!) hun koffie drinken, en worden uitgesloten. Sorry, maar DIT is asociaal.
Maar de meeste mensen glimlachen nog altijd als ze kleine kinderen zien, zeker in de Brusselse bussen. En ik heb zelfs van een Duitse moeder gehoord, dat de Brusselaars vriendelijker tegen kinderen zouden zijn dan in Stuttgart waar ze vandaan komt.
Malte Woydt, Lezersbrief aan Brussel Deze Week
12/03